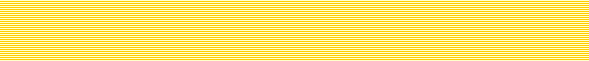Theologischer Konvent,
Europa und Bekenntnis-Ökumene
von Dr. theol. Lothar Gassmann
|
Der "Erste Ökumenische Bekenntniskonvent"
vom 13.–15. 10. 2004 in Freudenstadt
Lob von Kardinal Meisner
"Der Theologische Konvent der
Konferenz Bekennender Gemeinschaften mit seiner Zeitschrift DIAKRISIS
leistet einen weit wirksameren Beitrag zur Ökumene als viele
andere Gruppen." Dieses Zitat aus dem Munde des römisch-katholischen
Kardinals Joachim Meisner, Köln, war ein Höhepunkt des
Einführungsreferats von Prof. Dr. Peter Beyerhaus beim "Siebten
Europäischen = Ersten Ökumenischen Bekenntniskonvent"
(so die offizielle Bezeichnung), der mit rund 150 Teilnehmern
vom 13. bis 15. Oktober 2004 in Freudenstadt tagte. Er stand unter
dem Thema "Der christliche Glaube und die Zukunft Europas".
Über der Einladung zu dieser Veranstaltung (abgedruckt in
DIAKRISIS Nr. 3/Sept. 2004) war groß die Flagge der Paneuropa-Union
(gleichschenkliges Kreuz, umgeben von zwölf Sternen) abgebildet.
Die Paneuropa-Union setzt sich - laut ihrer Selbstdarstellung
- "für ein politisch, wirtschaftlich und militärisch
geeintes Europa als Gemeinschaft des Rechts, des Friedens, der
Freiheit und der christlichen Werte" ein. Zugleich hingen
im Tagungsraum im Freudenstädter Hotel Teuchelwald überall
kleine gelbe Plakate mit der Aufschrift "30 Jahre Bekenntnis-Ökumene".
Ökumenische Trägerschaft und Rednerliste
Träger der Veranstaltung war nicht
mehr nur - wie bisher - die (evangelische) Internationale Konferenz
Bekennender Gemeinschaften (Präsident: Prof. Dr. Peter Beyerhaus,
Gomaringen), sondern nun fand der Konvent erstmals "unter
Mitarbeit der Gustav-Siewerth-Akademie" (Gründerin:
Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Bierbronnen) statt, die eine entschieden
katholische Prägung hat. Zu deren Gründungsmitgliedern
gehört Joseph Kardinal Ratzinger, der Leiter der Vatikanischen
Glaubenskongregation. Im Jahr 2003 veröffentlichte die Gustav-Siewerth-Akademie
eine Festschrift zum 25-jährigen Pontifikats-Jubiläum
von Papst Johannes Paul II. mit dem Titel "Im Dienste der
inkarnierten Wahrheit". Diese Festschrift enthält Beiträge
von sämtlichen an der Gustav-Siewerth-Akademie lehrenden
Professoren, zu denen auch Peter Beyerhaus und dessen Stellvertreter
im Konvent, Prof. Dr. Horst W. Beck, zählen. Sie wurde -
so war in den bei der Tagung aufliegenden Mitteilungen der Akademie
zu lesen - "inzwischen dem Hl. Vater persönlich überreicht".
Entsprechend ökumenisch war die Zusammenstellung
der Referenten: Neben bekannten Rednern aus den evangelischen
Raum (Prof. Bodo Volkmann, Pastor Jens Motschmann, Pastor Ulrich
Rüß, Bischof i.R. Theo Sorg, Dr. Werner Neuer, Dr.
Rolf Sauerzapf, Prof. Edith Düsing, Dr. Horst Neumann, Prof.
Jörg Kniffka, Prof. Horst-W. Beck u.a.) traten einflußreiche
Katholiken mit zentralen Referaten auf, so z.B. Johanna Gräfin
von Westfalen, Prof. Alma von Stockhausen, Prof. Konrad Löw
und Prof. Horst Bürkle. In einer gemeinsamen Veranstaltung
mit Peter Beyerhaus unter der Überschrift "Die Neuevangelisierung
Europas in ökumenischer Sicht" übernahm der
bereits vor Jahren zur Römisch-katholischen Kirche konvertierte
Missionswissenschaftler Horst Bürkle den katholischen Part.
"Ökumenischer Bekenntnis-Gottesdienst"
Grußworte bei einem "Ökumenischen
Bekenntnis-Gottesdienst" in der Freudenstädter Stadtkirche
wurden überbracht vom katholischen Weihbischof Dr. Klaus
Dick aus Köln, vom orthodoxen Vikarbischof Basilaios aus
Bonn sowie von einem freikirchlichen Missionar aus Südafrika.
Ursprünglich hatte auch der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen
Allianz, FEG-Präses Peter Strauch, ein Grußwort zugesagt;
dieses war im Programm angekündigt; Strauch war jedoch verhindert.
Umrahmt wurde der Bekenntnis-Gottesdienst vom Freudenstädter
Dekan Ulrich Mack, vom Vorsitzenden der Konferenz Bekennender
Gemeinschaften, Pastor Ulrich Rüß (er intonierte die
liturgischen Wechselgesänge) sowie vom mit der Mission Kwasizabantu
verbundenen Euro-Chor mit rund 100 jugendlichen Sängern.
Die Predigt über den Beginn des Christentums in Europa hielt
der frühere württembergische Landesbischof Theo Sorg.
Gemessen an der großen Zahl der Mitwirkenden und der hochkarätigen
Besetzung war der Besuch des Gottesdienstes allerdings eher schwach;
die Kirche war insgesamt nur etwa zur Hälfte gefüllt.
"Im Geiste Otto von Habsburgs"
Eines der grundlegenden Referate der Tagung
sollte laut Programmankündigung der langjährige Internationale
Präsident der Paneuropa-Union und Europa-Parlamentarier,
Seine Kaiserliche Hoheit Dr. Otto von Habsburg, Pöcking,
halten, was sicherlich den relativ großen Besucherandrang
am ersten Nachmittag der Tagung erklärte. Der greise und
nach wie vor sehr einflussreiche Katholik (sein Vater, Kaiser
Karl I., war kurz vor dem Stattfinden des Konvents vom Papst selig
gesprochen worden) sollte über das Thema "Leitgedanken
einer christlichen Europapolitik in Auseinandersetzung mit sozialistischen
und liberalistischen Konzeptionen" sprechen. Aufgrund
der vorausgegangenen anstrengenden Romreise musste der Referent
jedoch absagen. Wie der Rektor der Gustav-Siewerth-Akademie, Graf
Albrecht von Brandenstein-Zeppelin, betonte, sei Otto von Habsburg
jedoch geistig gegenwärtig, denn "sein Lebenswerk ist
das Thema unserer Tagung: Der Kampf für ein christliches
Europa". Otto von Habsburg war von 1930 bis 2000 "Chef
und Souverän des Ordens vom Goldenen Vlies". Er gab
die Leitung aus Altersgründen an seinen Sohn Karl ab. Der
Orden vom Goldenen Vlies ist "der Jungfrau Maria gewidmet".
Sein Ziel ist "die Erhaltung des katholischen Glaubens, der
Schutz der Kirche und die Wahrung der unbefleckten Ehre des Rittertums"
(vgl. www.uni-protokolle.de/Lexikon/Orden_vom_Goldenen_Vlies.html).
Die doppelte Zielsetzung des Konvents
Die Zielsetzung des Theologischen Konvents
bei seiner Freudenstädter Tagung scheint eine doppelte zu
sein, wie aus den gehaltenen Referaten sowie aus dem bei dieser
Tagung vorgelegten und diskutierten "Freudenstädter
Aufruf" abgeleitet werden kann (die Endfassung wird zur Zeit
noch bearbeitet):
1. Die Verteidigung des christlich-ethischen Erbes in Europa;
2. Die Errichtung einer Bekenntnisökumene aus Evangelischen,
Katholiken und Orthodoxen.
Die Verteidigung des christlich-ethischen
Erbes in Europa
Der Konvent beklagte zu Recht den fehlenden
Gottesbezug in der Präambel des Verfassungsentwurfs der Europäischen
Union. Diese Ablehnung des lebendigen Gottes geht einher mit einem
rapiden moralischen und gesellschaftlichen Zerfall. Im "Freudenstädter
Aufruf" (Fassung vom 28.09.2004) werden hierbei vor allem
folgende Bereiche erwähnt: emanzipatorisches Denken im Gefolge
der Französischen Revolution; Selbstverwirklichung ohne Nächstenliebe;
Auflösung von Ehe und Familie; praktizierte Homosexualität;
Verlust von Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Treue; sinkende Geburtenrate
und Aussterbe-Effekt; sinkendes Leistungsniveau und steigende
Gewaltbereitschaft an Schulen; Gefahr durch islamistische Bewegungen
u.a. Eine neue Überprüfung des EU-Verfassungstextes
wird gefordert, insbesondere die Einfügung des Gottesbezuges
und "der Schutz der positiven und negativen Religionsfreiheit".
Letzteres wird deshalb als besonders wichtig angesehen, weil infolge
der sogenannten "Antidiskriminierungsgesetze" in einzelnen
Ländern bereits Christen vom Staat verurteilt wurden, die
z.B. Homosexualität als sündhaft bezeichnet hatten.
"Kirchen muß das Recht erhalten bleiben, ihrem prophetischen
Auftrag entsprechend Sünde im biblischen Sinn öffentlich
beim Namen zu nennen, auch wenn das einigen gewandelten Moralvorstellungen
und Gesetzestexten widerspricht", fordert in erfreulicher
Klarheit der "Freudenstädter Aufruf".
Die Errichtung einer "Bekenntnisökumene"
aus Evangelischen, Katholiken und Orthodoxen
Der "Freudenstädter Aufruf"
macht aber nicht nur den säkularisierenden Einfluß
der Französischen Revolution für den "geistlichen
Niedergang Europas" verantwortlich, sondern auch die "historischen
Glaubensspaltungen". In seinem grundlegenden Einleitungsreferat
zu Beginn des Konventes sprach Peter Beyerhaus im Blick darauf
die programmatischen Sätze: "Wir überschreiten
jetzt die Grenzen der Konfessionen. Bei der jetzigen Weltlage
können wir uns keine Fortsetzung der interkonfessionellen
Kämpfe mehr leisten." An den Abgrenzungen der Konfessionen
seien lediglich "verschiedene Auslegungstraditionen und kontextuale
Auslegungen der Bibel" schuld. Zwar solle die Wahrheitsfrage
nicht relativiert werden, aber man könne nicht mehr so einfach
in "Hetero- und Orthodoxie" (falsche und richtige Lehre)
trennen. Man solle "unterschiedliche Denkschulen" berücksichtigen
und eine "perspektivische Sicht der Wahrheit" erlernen.
Dann entdecke man: Es gebe ein "petrinisches, paulinisches
und johanneisches Christentum". Die Einheit dieser unterschiedlichen
Traditionsströme habe der russische Religionsphilosoph Wladimir
Solowjew "visionär vorweggenommen", indem er die
endzeitliche Einigung der getrennten Christen in seinem letzten
Werk "Kurze Erzählung vom Antichristen" beschrieben
habe.
Daß bei Solowjew, der von Beyerhaus sehr
häufig zitiert wurde, der Schlüssel zu seiner Vorstellung
der "Bekenntnis-Ökumene" liegt, wurde überaus
deutlich, etwa daran, dass er berichtete: "Auch der Ökumene-Beauftragte
des Vatikan, Kardinal Kasper, sagte mir: Ich reflektiere meine
ökumenische Aufgabe neu im Lichte dieses Buches von Solowjew."
So erklärt sich auch die - auf den ersten Blick erstaunliche
- Tatsache, dass bei einem Konvent über das Thema "Europa"
(!) ein Hauptreferat der Thematik gewidmet war: "Christus
oder Antichrist? - Die Aktualität der Visionen von Friedrich
Nietzsche und Wladimir Solowjew". Referentin war die in Köln,
Gießen (Freie Theologische Akademie) und Bierbronnen (Gustav-Siewerth-Akademie)
lehrende Philosophie-Professorin Edith Düsing.
Was "schaute" Wladimir Solowjew?
Wer war Wladimir Solowjew und was lehrte
er? Solowjew (1853-1900), Philosoph, Schriftsteller und Visionär,
beschäftigte sich in seinem Studium mit indischer, gnostischer
und mittelalterlicher Philosophie, besonders Mystik, Kabbala und
der Sophialehre. "Sein Denken kreist um die Sophia (göttliche
Weisheit) als personhafter Verkörperung des göttlichen
Urgrundes der Welt in weiblicher Gestalt, deren er auch in mystischer
Erfahrung teilhaftig wird. Als Neunjähriger bei der Liturgiefeier
etwa und im British Museum hat er entsprechende Visionen, die
sein System bekräftigen" (Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon, Verlag Traugott Bautz, Band 10, Spalten 763 f.).
Nachdem er 1881 für die Begnadigung der Zarenmörder
eingetreten war, kam er in Konflikt mit dem Staat und der damit
eng verbundenen Russisch-Orthodoxen Kirche und bekannte sich -
allerdings ohne zu konvertieren - zum Papst.
In seinem letzten Werk "Kurze Erzählung
vom Antichristen" beschrieb er - in einzelnen Punkten durchaus
an die Bibel anknüpfend, aber dann doch weit über sie
hinausgehend - die Bedrängnis und Verfolgung aller wahren
Christen durch den Antichristen. Bei einem "ökumenischen
Konzil der Gotteskirchen" zu Jerusalem - so spekuliert Solowjew
- treten wahre und abgefallene Christen einander gegenüber
und der Antichrist werde enttarnt. Diese Enttarnung nun nehmen
nacheinander Vertreter der drei führenden Konfessionen vor,
und zwar der römische Papst Petrus, der evangelische Professor
Pauli und der orthodoxe Starez Johannes. Am Ende der Erzählung
lässt Solowjew den vom Antichristen getöteten und von
Gott wieder zum Leben erweckten Starez Johannes sagen:
"Es ist Zeit, Christi letzte Bitte an
Seine Jünger zu erfüllen, dass sie eins würden,
wie Er selbst und der Vater eins sind. So lasset uns denn, Kindlein,
um dieser Einheit in Christo willen unserm lieben Bruder Petrus
die Ehre erweisen. Er soll es sein, der Christi Schafe zu guter
Letzt weidet. So sei es, Brüder!" Der evangelische
Professor Pauli stimmt der Vereinigung der Kirchen zu, woraufhin
am Himmel eine Frau erscheint - gehüllt in Sonne, zu Füßen
den Mond und auf dem Haupt eine Krone von zwölf Sternen.
Papst Petrus hebt seinen Stab und ruft: "Sehet, das ist
das Banner unserer Kirche! Folgen wir ihm nach!" Und
sie ziehen hinter dieser Erscheinung her zum Sinai.
Die Abgrenzung gegen "Ultra-Evangelikale"
Diese Erzählung kann den Leser
in der Tat faszinieren, da sie verkündet: Die Spaltung der
Christenheit besteht nicht zwischen den Konfessionen, sondern
innerhalb der einzelnen Konfessionen - im Sinne einer "Querspaltung"
zwischen "Liberalen" und "Konservativen" in
allen Lagern. Dies entspricht auch der Sicht von Peter Beyerhaus
und vieler seiner Mitstreiter, wie in zahlreichen Verlautbarungen
deutlich wird. So wird etwa die liberale und synkretistische "Genfer
Ökumene" des Weltkirchenrates - zu Recht! - abgelehnt.
Gleichzeitig aber wird eine Ökumene zwischen "bekennenden"
Evangelischen, Katholiken und Orthodoxen vertreten und immer deutlicher
praktiziert - so auch im Oktober 2004 in Freudenstadt. Wer auf
diesem Weg nicht mitgeht, wird neuerdings mit dem Attribut "Ultra-Evangelikaler"
belegt - so etwa in einem Artikel von Peter Beyerhaus unter der
Überschrift "Ultra-Evangelikalismus und Communio
Sanctorum" in DIAKRISIS Heft 3/2004, S. 171-179. Beyerhaus
schreibt:
"In ihrer radikalen ökumenischen
Selbstverweigerung stellen sich die Ultra-Evangelikalen in der
Tat außerhalb - ultra - der gesamten neuzeitlichen Einigungsbestrebungen.
Daran ändert gerade auch die Tatsache nichts, dass sich an
diesen ja nicht nur fast alle protestantischen Kirchen der Welt
beteiligen, sondern in zunehmendem Maße auch die großen
evangelikalen Verbände - darunter die Weltweite Evangelische
Allianz und die Lausanner Bewegung für Weltevangelisation,
v.a. aus missionarischen Gründen. Das alles wertet man hier
als ´Glaubensverrat`" (a.a.O., S. 177).
Warum gibt es unterschiedliche Konfessionen?
In der Tat ist heute in zahlreichen
Gremien, Verbänden und Gemeinden ein Umdenken erfolgt im
Sinne einer größeren ökumenischen Offenheit. Man
hört immer wieder - so auch bei Gesprächen am Rande
des Freudenstädter Konvents - die Argumente: "Wollen
Sie etwa bestreiten, dass es in den nichtprotestantischen Kirchen
wahre Christen gibt? Angesichts der Gottlosigkeit müssen
doch alle Christen zusammenstehen!" Darauf antworte ich:
Sicherlich freue ich mich über jeden Menschen, der an Jesus
Christus glaubt und die Bibel ernst nimmt. Die Frage ist nur:
Was ist rettender Glaube? Und wird die Bibel wirklich von allen
Kirchen als einzige Grundlage angenommen?
Jeder, der sich mit den verschiedenen Konfessionen,
ihren Lehren und ihrer Geschichte näher beschäftigt
hat, wird darauf nur antworten können: Hier gibt es gravierende
Unterschiede. Beispielsweise gilt in der Römisch-Katholischen
Kirche eben nicht allein die Bibel, sondern die Bibel (mitsamt
Apokryphen) und die Tradition, verbunden mit der "allein
richtigen" Auslegung durch das päpstliche Lehramt. Und
aus dieser Praxis heraus sind viele Sonderlehren (Fegfeuer, Marien-
und Heiligenverehrung, Reliquienkult, Rosenkranz, Totenmessen,
"Unfehlbarkeit" des Papstes usw.) entstanden, die im
Widerspruch zur klaren biblischen Lehre stehen.
In großer Deutlichkeit heißt es im
zeitgleich mit dem Freudenstädter Konvent erschienenen Informationsbrief
der Bekenntnisbewegung "Kein anderes Evangelium" Nr.
226 (Oktober 2004, S. 31):
"Konfessionen, zumal die reformatorischen,
sind ... deshalb entstanden, weil die römisch-katholische
Kirche von der Wahrheit des Evangeliums abgewichen ist und bis
heute eine irrende Kirche bleibt, und aufgrund entsprechender
kirchenrechtlicher Festlegungen als nicht reformierbar erscheinen
muß. Überwindung der Konfessionsgrenzen bedeutet Aufgabe
der Wahrheit. Zudem ist ´Spaltung` nicht nur schlecht, sondern
unter Umständen ´müssen Spaltungen sein, damit
die Rechtschaffenen ... offenbar werden` (1. Korinther 11,19).
Und gegenüber der römisch-katholischen Kirche müssen
sie bestehen."
Bei solchen Aussagen - das sei abschließend
betont - geht es keineswegs um "Katholophobie"
("Furcht vor Katholiken"), die Peter Beyerhaus seinen
"ultra-evangelikalen" Kritikern unterstellt (Ultra-Evangelikalismus,
S. 176f.), und schon gar nicht um eine persönliche Gegnerschaft
zu Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche. Es geht nicht
um ein psychologisches Problem, sondern allein um Jesus Christus
und die Frage der biblischen Wahrheit, die unseren reformatorischen
Vätern ausschließlich wichtig war und für die
sie bereit waren, Opfer zu bringen.
Dr. theol. Lothar Gassmann, Am Waldsaum 39, D-75175
Pforzheim
Literaturhinweis:
Erich Brüning / Hans-Werner Deppe / Lothar Gassmann: PROJEKT
EINHEIT.
Rom, Ökumene und die Evangelikalen, Betanien-Verlag, Oerlinghausen
2004
|
|